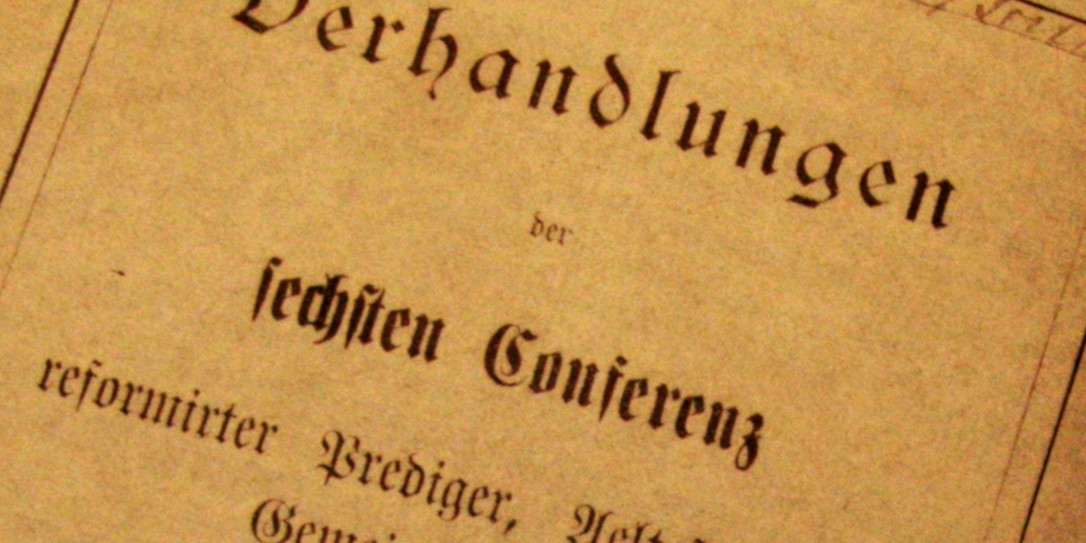Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1492-1549)
Ludwig XII. versuchte mehrmals, Marguerite als Braut in Europa zu verhandeln, aber weder ihre Aussichten, noch ihr Vermögen waren ausreichend, um eine internationale Ehe einzugehen. Stattdessen heiratete sie 1509, gerade siebzehn Jahre alt, den Herzog von Alençon, von dem wenig bekannt ist. Die Forschung geht meistens davon aus, dass sie und ihr Gatte wenig Gemeinsames hatten, zumal der Herzog vor Allem ein Soldat war. Dafür hatte sie aber eine geliebte Schwiegermutter, Marguerite von Lorraine, die eine zutiefst fromme Frau war. Jahre später schrieb Marguerite über ihren Tod und ließ ihre Trauer darüber durchblicken.
Als Ludwig XII. befürchten musste, nicht selbst Söhne zeugen zu können – er hatte „nur“ zwei Töchter, Claude und Renée de France – holte er Franz d´Angoulême an seinem Hof und gab ihm seine Tochter Claude zur Ehe. 1515 verstarb er und Franz bestieg als Franz I. den Thron Frankreichs.
Für Marguerite änderte sich das Leben schlagartig. Sie kam zu ihrem Bruder an den Hof, und da die Königin Claude sehr zurückhaltend und scheu war, übernahm sie bald die repräsentativen Pflichten. Zusammen mit ihrer Mutter bildete sie mit Franz ein Trio, die sogenannte „Dreieinigkeit“. Franz konnte immer mit seiner Mutter und seiner Schwester rechnen, und sie unterstützten ihn nach Kräften.
Franz I. wurde der erste Renaissancekönig Frankreichs. Er war jung, viril und plötzlich auch reich. Er ließ bauen an der Loire, eroberte das Herzogtum Mailand, versuchte sich als Deutschrömischer Kaiser wählen zu lassen – das war eine extrem teure Angelegenheit – und verwickelte sich in Rivalitäten sowohl mit Heinrich VIII. von England als auch mit Kaiser Karl V.
Schon 1516 verhandelte er ein Konkordat mit dem Pabst in Bologna. Die französische Kirche hatte seit dem Mittelalter ihre gallikanische Freiheiten gegenüber dem Pabst verteidigt, und als Frankreich sich als Nationalstaat festigen konnte und mit Franz I. fast die Grenzen erreicht hatte, die noch heute gelten, gelang es auch Franz, eine römisch-katholische Nationalkirche zu vereinbaren. Vor allem durfte er wichtige Posten in der Kirche mit seinen Kandidaten besetzen, die dann vom Pabst anerkannt wurden. Damit war die französische Kirche ihrem König treu ergeben, nicht desto weniger war sie streng katholisch, besonders die Fakultät der Theologie der Universität von Paris (oft abgekürzt Sorbonne genannt) wachte über die reine katholische Lehre. In den Jahren 1515 bis 1534 war Franz theologisch eher liberal und pfiff die eifrigen Theologen zurück, nach 1534 machte er mit ihnen gemeinsame Sache.
In Frankreich bildeten sich Kreise von Reformkatholiken und Humanisten, die der etwas verkrusteten katholischen Theologie kritisch gegenüberstanden. Sie forderten die Bibel in der Muttersprache und in den Händen von Laien. Sie kritisierten Heiligenkult und Reliquienverehrung, und versuchten eine Erweckung der Gläubigen im Sinne vom reformatorischen „sola fide, sola scriptura“ (= durch den Glauben allein und durch die Heilige Schrift allein) herbeizuführen. Der leitende Humanist war der alte Lefèvre d´Etaples (Faber Stapulensis), der nach Jahren als Herausgeber klassischer antiker Schriften endlich bereit war, die Heilige Schrift zu übersetzen. Er wurde unterstützt von Guillaume Briçonnet, Bischof von Metz. Dieser führte Reformen in seiner Diözese durch, legte die Bibelübersetzung des Lefèvre in den Kirchen aus, verjagte die Franziskaner, die sonst fast Predigtmonopol besaßen, und ließ durch seine eigene Leute „reformatorisch“ predigen. Unter ihnen waren Gérard Roussel, der später Hofkaplan bei Marguerite wurde, Guillaume Farel, der später in Genf als Reformator zusammen mit Calvin wirkte, und Simon Robert, der die frühere Nonne Marie Dentière heiratete und auch in die Schweiz zog.
Als katholischer Bischof wollte Briçonnet nicht die katholische Kirche umstürzen oder dem Pabst die Treue kündigen, er wollte dagegen die Kirche von innen erneuern. Er gehörte dem Reformkatholizismus an, der in Frankreich oft als „évangelisme“ bezeichnet wird, mit dem deutschen Wortbrauch „evangelisch“ aber wenig zu tun hat. Die Humanisten wie Erasmus von Rotterdam oder Lefèvre d´Etaples wollten zu den Quellen zurück, sie wollten die Bibel allen zugänglich machen, sie hatten von Paulus gelernt, dass Rechtfertigung durch den Glauben geschieht, aber er sah das alles nicht als Grund, die Einheit der Kirche auf Spiel zu setzen. Diese Männer prägten Marguerite.
An Bischof Briçonnet wandte sich Marguerite mit der Bitte um geistigen Beistand. Ein Briefwechsel folgte, der sich (nachweislich) über die Jahre 1521 bis 1524 erstreckte. Der Bischof schrieb lange Homilien, und Marguerite bat ihn ständig um mehr „seelische Nahrung“. Sie verwendete vermutlich seine schriftlichen „Predigten“ als Grundlage für Andachten mit ihren Hofdamen. Abschriften ließ sie in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis verteilen .
Briçonnet legte ihr die Bibellektüre ans Herz, mit besonderer Wertschätzung der Paulinischen Briefe. Nebenbei sei bemerkt, dass sowohl Luther als auch Calvin in jungen Jahren den Römerbrief auslegten, denn wer Erneuerung für die Kirche erhoffte, kam um Paulus nicht herum. Das Besondere bei Briçonnet war allerdings sein Hang zur Innerlichkeit, die Liebe zwischen Christus und der Seele, die Aufgabe des Selbst und das Hinschmelzen in Christus. Gute Werke, der Verdienst der Heiligen, Fasten und Pilgern kamen bei ihm dagegen nicht vor.
Für Marguerite bedeutete diese religiöse Erneuerung, dass sie anfing, geistliche Gedichte zu schreiben, ihre poetische Ader wurde freigelegt. Das erste Gedicht handelt von einer nächtlichen Vision. Ihre Nichte – die Tochter ihres Bruders – starb 1524 mit acht Jahren, und Marguerite fragt die reine Seele, was sie glauben soll. Der Antwort ist klar, sie soll Christus allein lieben und glauben. Briçonnet hätte es nicht besser ausdrucken können.
In diesen Jahren wurden Luthers Schriften in Frankreich verbreitet und wir wissen mit Sicherheit, dass Marguerite seine Schriften kannte. Die theologische Fakultät der Universität von Paris leistete Widerstand gegen die lutherische Ketzerei und das bekam Bischof Briçonnet zu spüren. In seinen Briefen an Marguerite bat er sie wiederholt um Unterstützung und besonders darum, dass sie ihren Bruder und ihre Mutter für seine Reformen gewinnen möge. Marguerite hatte zwar großen Einfluss auf ihren Bruder, aber trotzdem musste Briçonnet alle seine Reformvorhaben aufgeben. Die Gruppe um ihn flüchtete nach Straßburg, während er selbst widerrufen musste. Er starb kurze Zeit später.
1524 starb Königin Claude, und Marguerite wurde mit der Aufsicht der königlichen Kinder betraut. Aus ihrem Briefwechsel wissen wir, wie sehr diese Kinder ihr ans Herz wuchsen. Ihre Ehe blieb kinderlos – ihre Trauer darüber vernimmt man in den Briefen an Briçonnet – und jetzt konnte sie ihre mütterlichen Gefühle den Kindern ihres geliebten Bruders zu Gute kommen lassen.
1525 verlor Franz I. die Schlacht bei Pavia in Norditalien. Seit vielen Jahren, schon in der Regierungszeit Karl VIII. hatte Frankreich mit den italienischen Stadtstaaten Krieg geführt. Jetzt stießen in Italien die habsburgischen und die französischen Truppen zusammen. Die Blüte des französischen Adels wurde an einem Tag vernichtet, und Franz selbst wurde gefangengenommen. Der Herzog von Alençon flüchtete vom Schlachtfeld und starb wenige Monate später, von seiner Gattin liebevoll gepflegt.
Jetzt schlug die Stunde für Marguerite. Mit ihrer Mutter hatte sie in Lyon den Ausgang des Krieges abgewartet, und nach dem Tod ihres Gatten ließ sie ihre Mutter als Regentin Frankreichs zurück, sie selbst segelte und ritt zu ihrem Bruder, der schwer krank in Madrid im Gefängnis lag. Sie pflegte ihn wieder gesund und versuchte mit dem unerbittlichen Kaiser Karl V. zu verhandeln. Sowohl sie als auch Franz dachten, dass der ritterliche Ehrencodex seine Befreiung möglich machen würde, Karl war aber auf handfeste Vorteile aus. Am Ende versprach Franz alles, um freizukommen, fuhr nach Hause, gab seine Söhne quasi als Unterpfand dem Kaiser und musste eine Riesensumme als Lösegeld aufbringen.
Als Regentin hatte die streng katholische Louise von Savoyen die französische Kirche in ihrem Kampf gegen die „Ketzer“ unterstützt, deshalb war auch keine Hilfe für Briçonnet und seine Leute zu erwarten. Nach der Rückkehr Franzens war er noch abhängiger als zuvor von der Kirche, nur sie konnte ihm mit dem Geld, das er dem Kaiser schuldete, versorgen. Anders als die deutsche Fürsten, die sich sehr wohl handfeste Vorteile von der Reformation in ihren Ländern erhoffen konnten, hatte der französische König schon eine (katholische) Nationalkirche, die ihn kräftig unterstützte, natürlich in der Annahme, dass er keine „Ketzer“ dulden würde.
Marguerite war eine noch junge Witwe, und ihr zweiter Gatte war ein junger, strahlender Held: Henri d´Albret, König von Navarra. Er hatte sich in der Schlacht von Pavia tapfer geschlagen, war gefangen genommen worden, hatte sich aber in einer „Mantel und Degen Aktion“ buchstäblich erfolgreich abgeseilt. Er war zudem ein Frauenheld und 12 Jahre jünger als Marguerite. Sein Königreich war winzig: das Königreich Navarra war ursprünglich das, was wir heute das Baskenland nennen, ein Gebiet, das sich beidseitig über den Pyrenäen erstreckte, jedoch sein Schwerpunkt auf der Südseite der Bergkette mit Pamplona als Hauptstadt hatte. Die Albrets, als südfranzösische Großgrundbesitzer, waren durch Heirat an die Krone gekommen, nur um erleben zu müssen, dass Spanien 1512 der Gebiet um Pamplona eroberte. Damit schrumpfte das Königreich auf Basse-Navarre zusammen, der französische Teil des Baskenlandes. Da er auch Vicomte von Béarn war, eine unabhängige Grafschaft mit eigener Regierung und Generalständen, hatte er dennoch sein eigene Hausmacht. Er erwartete, sozusagen als Mitgift, dass Franz ihm helfen würde, ganz Navarra zurückzuerobern. Franz dagegen erwartete, dass er die Grenze gegen Spanien verteidigen würde und machte ihn zum Oberbefehlshaber in Guienne, eine Bezeichnung für Südwestfrankreich von den Pyrenäen bis Loire, vom Atlantik bis Auvergne.
Was Marguerite erwartete, wissen wir nicht. Ihre Ehe bedeutete für sie eine Zerreißprobe zwischen dem geliebten Bruder und dem Ehemann, und es war für sie nicht einfach, beiden gegenüber loyal zu sein.
Ihre Ehe bedeutete aber auch, dass sie endlich Mutter wurde. 1528 gebar sie ihre Tochter, Jeanne d´Albret, danach einen Sohn, der kurz nach dem Geburt starb, und dann – sie wurde ja nicht jünger – hatte sie eine Reihe von Fehlgeburten und Scheinschwangerschaften.
Als Königin mit eigenem Herrschaftsgebiet konnte sie jetzt Glaubensflüchtlingen Schutz bieten. Bei ihrem Bruder trat sie immer noch für Andersdenkende ein, sie konnte aber jetzt in Bourges luthersche Studenten und Dozenten an die Universität holen, sie brachte den alten Lefèvre d´Etaples bei ihrem Hof in Nérac unter, sie machte Gérard Roussel zum Bischof von Oloron, und sie stellte als Sekretäre bekannte humanistische Skribenten ein, unter ihnen Clément Marot, Dichter und Verfasser vom ersten gereimten französischen Psalter.
Anfänglich blieben sowohl sie wie ihr Gatte am Hofe. Sie verhandelte zusammen mit ihrer Mutter und Margaretha von Habsburg, Statthalterin der Niederlande, den sogenannten Damenfrieden von Cambrai aus. Sie empfing Botschafter, verhandelte mit dem Pabst, und hatte immer noch die Aufsicht über die königlichen Kinder. Sie reformierte Klöster überall in Frankreich, ihre Lektüre der Lutherschrift „Von den Mönchsgelübden“ hatte sie nicht dazu gebracht, die Klöster abzuschaffen, sondern eher Missstände abzubauen.
1531 veröffentlichte Marguerite ihr religiös-poetisches Werk „Ein Spiegel der sündigen Seele“. Die zweite Ausgabe 1533 wurde von der Sorbonne als ketzerisch verurteilt und verboten. Wütend verlangte Franz I. die Rücknahme der Verurteilung, und die Universität fügte sich schleunigst. Als dann, 1534, die Plakataffäre mit ihrem Angriff auf die Messe und das katholische Abendmahlverständnis die Gemüter erregte, ging sie nach Südfrankreich. Dort konnte sie unter Anderen einem Flüchtling, dem jungen Calvin, weiterhelfen. Sie hatte seit jungen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu ihrer Cousine, Renée de France, Herzogin von Ferrara, gepflegt, und jetzt schickten die zwei gleichgesinnten Verwandten einander hilfsbedürftige Glaubensflüchtlinge zu.
In den nächsten Jahren war das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester etwas abgekühlt. Franz I. unterstützte die römisch-katholische Kirche nach Kräften, und Marguerite war vorsichtig geworden. Als der Berater des Königs ihn aber fragte, ob Gefahr bestünde, Marguerite könne zum Protestantismus übertreten, erwiderte der König: „Dafür liebt sie mich zu sehr!“, und behielt Recht damit.
Die Ruhe und Abgeschiedenheit am Hofe bedeutete für Marguerite Zeit für eine rege schriftstellerische Tätigkeit. Die religiösen Gedichte waren wohl eher eine Art meditative Übung inmitten der oberflächlichen Geschäftigkeit des Hofes. Jetzt verfasste sie Schauspiele, die am Hof aufgeführt wurden. Angeregt durch die Beschäftigung mit den Schriften des Plato, die sie durch den italienischen Humanisten Pico della Mirandola und Marsilio Ficino kennengelernt hatte, dachte sie über das Wesen der Liebe nach, und ihre schriftstellerische Tätigkeit wurde von diesen Überlegungen geprägt. Sie ließ Platos Schriften ins Französisch übertragen, so wie sie auch die Novellen von Boccaccio, „Dekameron“, übersetzen ließ. Diese Novellen beeinflussten ihre berühmteste Werk, die Novellen, aus denen das „Heptameron“ besteht, und die von ihr über einen längeren Zeitraum zusammengefügt wurden. Sie gab nur ein Buch in Druck, „Les marguerites de la Marguerite des princesses“, die Perlen der Perle (Marguerite) der Prinzessinnen, mitsamt dem Folgeband: „Suyte des marguerites“ (1547). Alle andere Schriften von ihr waren zu ihren Lebzeiten nur als Manuskript vorhanden, aber das Heptameron wurde ungefähr zehn Jahren nach ihrem Tod als Buch herausgegeben, und zählt seitdem zu den Klassikern des 16. Jahrhunderts, obwohl es oft missverstanden worden ist – dazu mehr später (vgl. Nielsen, Theologie als Erzählung).
Eine andere wichtige Angelegenheit in den letzten Jahren, ihr Verhältnis zu ihrer Tochter Jeanne, wird im Artikel über diese behandelt. In den letzten Jahren hatte sie eine Auseinandersetzung mit Calvin über die Freigeister, die sich bei ihrem Hof aufhielten. Ihre Bedeutung für die Reformation wird später untersucht. Klar ist allerdings, dass sie als Katholikin starb. Als ältere Frau zog sie sich immer öfters in Klöstern zurück und auch, wenn sie nie besonders rechtgläubig war, trat sie nie aus der Kirche aus. Sie starb 1549 auf ihrem Schloss Odos.
Marguerite d`Angoulême war eine hoch begabte, zutiefst fromme Frau. Sie ging unbeirrt ihre eigenen Wege, und auch, wenn sie diskret war, ließ sie sich nicht einschüchtern. Ihre Verdienste für die Verbreitung der Reformation sind offenkundig, und in Genf wusste Calvin sehr wohl, wie dankbar er ihr sein musste. Dabei war die geistige Freiheit ihr ohne Zweifel eine Herzensangelegenheit, während ihre Tochter und Enkelin mit Nachdruck Partei ergriffen. Zu Marguerites Zeiten waren diese geistige Freiheit und die Hoffnung, die katholische Kirche von innen zu erneuern und zu „reformieren“, ohne die Glaubensspaltung vollziehen zu müssen, noch möglich. Diese Umstände gaben ihr etwas Spielraum, den spätere Generationen nicht länger hatten.
Literatur
In Deutschland ist die Literatur zu Marguerite d´Angoulême übersichtlich. Zu erwähnen sind:
Margarete von Navarra: Das Heptameron, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1960, mit einem ausgezeichneten Nachwort von Peter Amelung. Neudruck München 1979, 1999 (dtv 12710)
Eltz-Hoffmann, Lieselotte von: Kirchenfrauen der frühen Neuzeit, Stuttgart 1995
Kraus, Claudia: Der religiöse Lyrismus Margaretes von Navarra, München 1981
Schönberger, Axel: Die Darstellung von Lust und Liebe im Heptaméron der Königin Margarete von Navarra, Frankfurt a/M 1993
Sckommodau, Hans: Die religiösen Dichtungen Margaretes von Navarra, Köln 1955
Sckommodau, Hans: Galanterie und vollkommene Liebe im „Heptaméron“, Münchener Romanistische Arbeiten, Band 46, München 1977
Sckommodau, Hans: Die spätfeudale Novelle bei Margareta von Navarra, Sitzungsbericht der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt, Bd. XIV, Nr. 4, Wiesbaden 1977
Zimmermann, Margarete: Der Salon der Autorinnen: französische „dames de lettres“ vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert, Berlin 2005
Stedman, Gesa & Zimmermann, Margarete: Höfe – Salons – Akademien, Hildesheim 2007
Hinzu kommt eine Übersetzung:
Febvre, Lucien: Margarete von Navarra. Eine Königin der Renaissance zwischen Macht, Liebe und Religion, Frankfurt a/M 1998 (Originaltitel: Autour de l´Heptaméron: Amour sacré, amour profane, Paris 1996)
Allgemeine Kirchengeschichte:
Strasser-Bertrand, Otto Erich: Die evangelische Kirche in Frankreich, in: Die Kirche in ihrer Geschichte, Göttingen 1975
In Frankreich zählt sie zu den wichtigen Renaissancedichterinnen. Eine vollständige wissenschaftliche Ausgabe ihrer Werke von Nicole Cazauran ist in Arbeit:
Marguerite de Navarre: Oeuvres Complètes, Paris 2001. Bisher erschienen:
Heptaméron, Paris 2000 und die Bände 1,3,4,8 & 9
Die klassische Biografie ist:
Jourda, Pierre: Marguerite d´Angoulême, duchesse d´Alençon, reine de Navarre (1492-1549), Étude biographique et littéraire, Paris 1930, Genf 1978
Jourda, Pierre: Répertoire analytique et chronologique de la Correspondance de Marguerite d´Angoulême, Duchesse d´Alençon, reine de Navarre (1492-1549), Paris 1930
Christine Martineau, Michel Veissière & Henry Heller: Guillaume Briçonnet/Marguerite de Navarre: Correspondance, 2 Bd., Paris 1975-79
Herminjard, Aimé, hrsg.: Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, Genf 1886-79
In Heptaméron, ed. Nicole Cazauran, ist weiterführende Literatur erwähnt. Hier verweise ich nur auf drei Kolloquien aus dem Jahr 1992:
Marguerite de Navarre, 1492-1992, Actes du Colloque international de Pau (1992), Mont-de- Marsan 1995
Etudes sur l´Heptaméron de Marguerite de Navarre, Colloque de Nice, 15-16 Fèvrier 1992, Uni.de Nice, o. J.
Marguerite de Navarre, Actes du colloque international du 14 au 16 septembre 1992, Lódź 1997
Karlsson, Britt-Marie: Sagesse divine et folie humaine, Etude sur les structures antithétiques dans l´Heptaméron de Marguerite de Navarre (1492-1549), Göteborg 2001
Montaigne: Oeuvres complètes, Paris 1962
Ausgewählte Literatur in englischer Sprache:
- Patricia F. Cholakian & Rouben C. Cholakian: Marguerite de Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006
- Cholakian, Patricia F.: Rape and Writing in the Heptameron, Carbondale 1991
- Cottrell, Robert D.: The Grammar of Silence, A Reading of Marguerite de Navarre´s Poetry, Washington D.C. 1985
- Davis, Betty J.: The Storytellers in Marguerite de Navarre´s Heptaméron, Lexington 1978
- Davis, Natalie Zemon: Society and Culture in Early Modern France: eight Essays, Stanford 1975
- Farge, James K.: Orthodoxy and Reform in Early Reformation France, The Faculty of Theology of Paris, 1500-1543, Leiden 1985
- Ferguson, Gary: Mirroring belief: Marguerite de Navarre´s Devotional Poetry, Edinburgh 1992
- Gelernt, Jules: World of Many Loves, The Heptameron of Marguerite de Navarre, Chapel Hill 1966
- Greengrass, Mark: The French Reformation, London 1987
- Salmon, J.H.M.: Society in Crisis, France in the Sixteenth Century, London 1975
- Tetel, Marcel: Marguerite de Navarre´s “Heptaméron”: Themes, Language and Structure, Durham N.C. 1973
Nicht mit dem Strom geschwommen: Karl Barth als Lehrer der Versöhnung
Der Triumph Jesu Christi und der Tanzlehrer Heiliger Geist

Alle Dogmatik ist für Karl Barth Christologie, so auch die Versöhnungslehre, das sei vorweg gesagt. Das solus Christus durchzog das dritte internationale Barth Symposion in Emden, auch dort, wo das im Folgenden nicht gesagt ist. „Es gibt gottlose Menschen, aber: Es gibt keine Menschenlosigkeit Gottes“, erinnerte Matthias Zeindler, Professor in Bern, an ein Diktum Barths und sein konsequentes Verständnis des solus Christus.
Barth glaubte nicht an die „Allversöhnung“, wie es bei einem Theologen, der sich für „die souveräne Dominanz der göttlichen Gnade“ aussprach, vermutet werden könnte, sondern an den „Allversöhner“.
Den von Barth einst im Römerbrief selbst genannten „Triumph der Gnade“ deutete er später als „Triumph Jesu Christi“. Der Triumph eines Prinzips – und sei es der der sola gratia – galt es zu vermeiden.
22 Vorträge und zwei Podien von Theologie-Lehrenden aus der Schweiz, den Niederlanden, den USA und Deutschland widmeten sich einem Teil der Kirchlichen Dogmatik (IV), der gegenüber der kirchlichen Tradition keinen Stein auf dem anderen lässt und voller theologischer Entdeckungen steckt. Dies jedoch hat die Rezeptionsgeschichte bis heute kaum wahrgenommen. Das wurde gleich zur Eröffnung der Tagung festgehalten, als der Systematikprofessor Christian Link, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Karl Barth-Gesellschaft e.V., und Marius Lange van Ravenswaay, Direktor der Johannes a Lasco Bibliothek, das Symposion eröffneten.
Die Versöhnungslehre in KD IV schrieb Barth in den Jahren 1951-1968, während – anscheinend wenig versöhnlich – Ost und West sich gegenüberstanden im Kalten Krieg, der, so der Historiker George Harinck, besser Kalter Friede zu nennen sei.
Freiheit des Evangeliums und Engagement für diese Welt
Mit einer steilen These begann die Auseinandersetzung um Barths Stellungnahme zwischen den Fronten Ost und West nach dem Krieg. George Harinck, Professor in Amsterdam, urteilte: Barths Haltung im Kalten Krieg, zwischen den Fronten von West und Ost einen dritten Weg zu suchen, dem die Freiheit des Evangeliums vorangestellt sei, ohne zum Widerstand gegen die real existierenden kommunistischen Regime aufzurufen, verkenne, dass diese Theologie der Freiheit eine Frucht westlicher Kultur sei. Nicht Barths Haltung im Kalten Krieg bedürfe jedoch einer Erklärung, sondern sein Aufruf zum Widerstand gegen das NS-Regime. Diese sei nicht seiner Theologie, sondern den persönlichen Umständen zu verdanken, konstatierte der Historiker.
Barth habe die Freiheit der Theologie verteidigt für eine Kirche, die durch Totalitarismus bedrängt werde, aber auch für eine, die Existentialismus bedränge. Sein Ausgangspunkt sei nicht der Staat gewesen, sondern die Kirche, betonte Harinck. Der Kirche hinter dem „Eisernen Vorhang“ riet er zur Geduld. Öffentlich habe Barth nicht gegen kommunistische Diktaturen Stellung bezogen, sich in privaten Briefen aber sehr wohl kritisch geäußert. Außerdem setzte er sich für die Befreiung inhaftierter Pfarrer in der DDR ein - im Sinne seiner Überzeugung, die Kirche bekämpfe keine Systeme, sondern spreche in einer konkreten Situation, wo „Not am Mann“ sei. Befragt, warum er nicht zum Widerstand gegen Unrechtsregime im Osten aufriefe, war eine Antwort Barths, anders als zur Zeit des Nationalsozialismus habe er nicht vor dem Kommunismus zu warnen, da dieser im Westen schon allgemein abgelehnt werde.
Widerspruch und Widerstand
Harincks Ausführungen und seine These blieben nicht unwidersprochen.
Ihm persönlich habe Barth den Widerstand gelehrt, sagte Michael Beintker, der 1965 in Jena Abitur machte und seine Laufbahn noch vor der „Wende“ als Wissenschaftler in Halle begann.
Rinse Reeling Brouwer, Professor in Groningen und Amsterdam, rief in Erinnerung, Barth habe die Identifikation von Adenauers Politik - samt Wiederaufrüstung! - mit dem Christentum kritisiert und sei deshalb im Westen problematisch geworden. Barths eigene Haltung im Kalten Krieg erklärte Reeling Brouwer damit, wie Barth selbst beschrieb, „was unter dem dem Christen zum Tragen gegebenen Kreuz konkret zu verstehen“ sei:
„Sie werden den Einen als allzu asketisch erscheinen und den Anderen als allzu unbesorgte Lebensbejaher – hier als Individualisten und dort als Kollektivisten, hier als Autoritätsgläubige und dort als Freigeister, hier als Optimisten und dort als Pessimisten, hier als Bourgeois und dort als Anarchisten. Sie werden selten bei der in ihrer Umgebung herrschenden Mehrheit zu finden sein. Sie werden jedenfalls nicht mit dem Strom schwimmen.“ (KD IV/2,689f.)
In der Polemik gegen Barths vermeintliche Sympathie mit dem Kommunismus wurde ihm vorgeworfen, er habe die Untaten im Osten verschwiegen. Dies war jedoch nicht so, nur wurde die Kritik Barths nicht mitzitiert, so Peter Zocher, Leiter des Karl Barth-Archivs in Basel, über die heftigen Angriffe gegen Barths Äußerungen in der Schweiz referierte.
Das einzige, was man Barth in der damaligen Situation im Nachhinein vorhalten könne, sei, dass er nicht gesehen habe, wie erfolgreich das „Demokratieimplementieren“ im Westen Deutschlands dann doch gewesen sei.
Umkehr-Ökumene
Von den zahlreichen Themen, u.a. Predigt, Sakramentsverständnis (dazu später mehr auf reformiert-info), Mission und Sünde, war der Ökumene mit einem Podiumsgespräch ein besonderer Raum gewidmet.
Die Kirchenhistorikerin Andrea Strübind, Professorin in Oldenburg und selbst Baptistin, zeigte sich überrascht, keine nennenswerte Rezeption von Barths Tauflehre mit ihrer Kritik an der Kindertaufe und ihrem Verständnis der Wassertaufe als menschliche Antwort im Glauben auf Gottes Gnadengabe unter den weltweiten Baptisten gefunden zu haben, lediglich eine indirekte im US-Baptismus, in Deutschland gar keine. Letzteres führte sie zurück auf das „Unverhältnis“ zwischen Freikirchen und Landeskirchen und die Desolidarisierung der baptistischen Kirche mit der Bekennenden Kirche 1937. Außerdem gäbe es auch kein einheitliches Taufverständnis unter den Baptisten. Die einen sähen Taufe als Gehorsamsschritt, die anderen betonten das Handeln Gottes in der Taufe als Heilszuspruch.
Nach der zweiten ökumenischen Vollversammlung in Evanston 1954, wo Barth erfolglos versucht hatte, den ÖRK von der Relevanz Israels als ökumenische Frage zu überzeugen, wie Michael Weinrich, selbst Ökumene-Fachmann in Bochum, ausführte, habe er sich entschieden, seine Kraft in die Fortführung der KD zu stecken anstatt in ökumenische Verlautbarungen.
Das solus Christus als soteriologisches Leitkriterium
Als bleibender Impuls blieb Barths Ansatz, die Konzentration ökumenischer Gespräche auf die Ekklesiologie zu verschieben auf die Gemeinsamkeit des Gottesbekenntnisses sowie seine Bestimmung der Ökumene als eine Umkehrbewegung, als eigene Umkehr, wohlgemerkt. Dazu gehöre für sie aber auch die Traditionskritik, ergänzte Johanna Rahner, Dogmatik-Professorin an der katholischen-theologischen Fakultät in Tübingen.
Einen Beitrag zur konfessionellen Ökumene bot in diesem Sinne auch Michael Beintker in seinem Vortrag über Rechtfertigung – Heiligung – Berufung. Nicht mit der Rechtfertigung allein stehe und falle der Glaube. Das solus Christus sei Barth „soteriologisches Leitkriterium“. Der Glaube könne nicht um seiner selbst willen wichtig sein, das sei die Pointe bei Barth gewesen. Das Christusbekenntnis habe er in einer „Fixierung auf narzisstische Frömmigkeit“ bedroht gesehen.
Was heißt Rechtfertigung? In Abgrenzung zu Luthers Ausgangsfrage „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“, habe Barth gefragt: „Wie kommt Gott zu seinem Recht?“ Und: „Wie kommt der Mensch als Täter des Unrechts zu seinem Recht?“ Es handle sich also um das Problem Gottes mit dem Menschen.
Gottesfrage und Eschatologie
Wie es sich für eine Theologie geziemt, die beim Gott-Nach-Denken anfängt, entzündete sich eine erregte und aufregende Debatte an der Frage nach Gottes Unveränderlichkeit. Barth schrieb, so führte Bruce McCormack, Professor in Princeton, aus: „that a God who would remain unaffected in His being as God by the incarnation is a God who is ‚dead of sheer majesty‘.“ (KD IV/2,93).
Doch was heißt das für die Theologie heute? Die immanente Trinität von der Christologie her zu entfalten, sagt McCormack, der dafür plädiert, die Verbindung von der Unveränderlichkeit Gottes und der Unfähigkeit zu leiden innerhalb reformatorischer Theologie zu trennen: „severing the connection between immutability and impassibility might well be the most important contribution one could make to restoring theological health and vitality to the churches of the Reformation.“
Das Fragen ging weiter: Ist nicht auch das Gericht Gottes, ein Gericht, das Gott durchführt und eins, in dem er selbst vor Gericht steht und in Fragen der Theodizee zur Verantwortung gezogen wird? Wird der Gott, der sich in seinem vollendeten Reich dem Menschen zuwendet, anders sein, als der/die sich in Jesus Christus den Menschen zugewandt hat? Besteht Gottes Unveränderlichkeit in seiner Leidensfähigkeit? Oder kennzeichnen ihn/sie immerwährend gleich Liebe und Gnade? Hat sich Gott nicht längst als die sich Verändernde offenbart, in seiner Reue, in Jesus Christus, als Gott in Beziehung zum Menschen?
Kunst und Glaube: die Kathedrale Feinigers
Die Kunst sei ein Thema der Eschatologie bei Barth, sagte Michael Trowitzsch in einem Nebensatz, während ein paar Meter weiter die Emder Kunsthalle Holzschnitte Lyonel Feinigers zeigte. Im Mittelpunkt dieser Bilder steht eine Kathedrale als „sinnbildliche Darstellung“ des „Baus der Zukunft“, den das Bauhaus in Weimar erschaffen wollte. Sein Gründer, Walter Gropius, schrieb 1919: Architektur, Plastik und Malerei „aus Millionen Händen der Handwerker“ werde einst gen Himmel steigen „als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens“.
Es gebe „mehr säkulare Soteriologie, als wir denken“, sagte Beintker zum Abschluss der Tagung und erinnerte aufmunternd an den Anfang von Barths Versöhnungslehre: das Immanuel. „Gott-mit-uns“, dieser Zuspruch sei auf den Koppelschlössern der in den Krieg ziehenden Soldaten pervers missbraucht worden, aber durch Jesus Christus werde er zu einem Wort, das wir gebrauchen können.
Kampf und Tanz
Karl Barth weiterzudenken und einen Weg „in zukünftige Theologie“ zu gehen, forderte nicht nur Michael Trowitzsch, Professor in Jena, mit einem Vortrag zur Eschatologie der Versöhnungslehre.
Doch dies ist ein steiniger Weg in die Fremde:
a) Auf ihm lauert die Sünde der Trägheit. Auch das TheologInnen-Ich ist ihr nicht gefeit, wenn es zu sich spricht:
„Gott, das hyperaktive Aktionsbündel, lass‘ ich einfach laufen.“ (Frei nach Stephan Schaede, Akademiedirektor in Loccum)
b) Und es gibt die Anfechtung. Auch dort, wo Theologie „als quicklebendiges, der bewegenden Beweglichkeit ihres Gegenstandes entsprechendes Ereignis“ geschieht, wie Magdalene L. Frettlöh, Professorin in Bern, sie sich wünscht, sei ihr gerade in der Anfechtung mit Barths geradezu kämpferisch hart formulierten Appell des Aushaltens und Ertragen allein nicht geholfen. Frettlöh vermisst in Barths „Einführung in die Evangelische Theologie“ das Kyrie eleison, das „an Gott gerichtete Fragen, Klagen und Anklagen“.
Selbst begeistert von Barths „Einführung“, die sie lese „als eine pneumatologisch fokussierte und doxologisch perspektivierte Rechenschaft einer als Weisheitslehre konzipierten durchgängig dialektischen Theologie“, stellte Frettlöh den Aufbau des kleinen Buches mit seiner dreifach viergliedrigen Struktur dar als Tanz der Quadrille, dem Kontratanz mit vier Personen, in dem sich der Geist „als der Tanzlehrer“ erweise.
Im Blick auf den Entwurf einer eigenen Theologie, benannte Frettlöh, was bei ihrem „Lehrer“ Karl Barth fehlt: Mit der Vermittlung theologischer Erkenntnis nach außen lasse Barth uns allein.
Stellvertretend für alle anwesenden Theologie Lernende und Lehrenden fragte sich Cornelis van der Kooi, Professor in Amsterdam:
Ist nun eine Einladung zum Kampf oder zum Tanz gesprochen?
Ende mit Zukunft
Am Ende der akademischen Vorträge, deren Pointen zu verstehen gute Vorkenntnisse in Dogmengeschichte voraussetzte, konnte ein renommierter Barth-Forscher wie Bruce McCormack seine eigene Arbeit an der Versöhnungslehre in die Frage fassen:
Wie kann ich Versöhnung leben mit einer Person, die sie nicht mit mir leben will?
Unter den golden schimmernden Kronleuchtern der Johannes a Lasco Bibliothek fanden die Herausforderungen, wie John G. Flett, Assistent in Wuppertal/Bethel, sie aus eigener Erfahrung erzählte, kaum Widerhall: Wenn er beim Besuch einer theologischen Fakultät feststellen müsse, ihre Bibliothek lasse sich auf einem Sechstel der Regalbretter seiner privaten Sammlung an Fachliteratur unterbringen; wenn Theologen an einem gemütlichen Ort in einem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land ihr Bier tränken, während wenige Meter entfernt ein Unglück geschähe und sie wüssten: Es wird noch nicht einmal ausreichend ärztliche Versorgung für die Verletzten geben.
Die Vorträge des vom Seminar für Reformierte Theologie der westfälischen Wilhelms-Universität Münster, dem Seminar für evangelische Theologie der Universität Siegen, der Karl Barth-Gesellschaft e.V. und der Johannes-a-Lasco Bibliothek in Emden veranstalteten Symposions werden als Sammelband beim Theologischen Verlag Zürich (TVZ) erscheinen.
Die Bände „Emden I“ (2005): Karl Barth in Deutschland (1921-1935) und „Emden II“ (2010): Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935-1950) liegen bereits vor. Emden III wird folgen und die Hoffnung sagt: auch Emden IV.
Nachtrag:
Zu viel Verehrung des Kirchenvaters des 20. Jahrhundert? Die heutigen BarthianerInnen wissen, um die Anekdote, die Georg Plasger, Professor in Siegen, in einer Pause beim Tee erzählte:
Barth gab einem Theologen den Rat:
„Wenn Sie einen Barthianer treffen, sagen Sie ihm: Ich bin keiner!“
Barbara Schenck, 5. Mai 2014
Nicht der Rechtfertigungsartikel, sondern das solus christus, die Christologie sei der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt, davon war Karl Barth überzeugt. Allein diese Erkenntnis wäre es wert, aktuell im evangelisch-katholischen Gespräch zu leuchten, aber die Barthsche Rechtfertigungslehre biete noch mehr „Türen für weitergehende Einsichten“, so Professor Michael Beintker auf dem Barth-Symposion Anfang Mai in Emden.
„Jesus Christus ist das eine Sakrament“ sagt Karl Barth in der Kirchlichen Dogmatik (KD). Was bedeutet das für die menschliche Freiheit und Gottes Souveränität? Fragt Michael Weinrich in seinem Emder Vortrag 2014.
Emden. Kirchenpräsident Martin Heimbucher hat am Donnerstag, 1. Mai 2014, beim dritten Emder Karl-Barth-Symposium an die direkten Verbindungen Karl Barths nach Emden erinnert.
Zum Internationalen Symposion Karl Barth als Lehrer der Versöhnung: Vertiefung - Öffnung - Hoffnung laden ein: das Seminar für Reformierte Theologie der westfälischen Wilhelms-Universität Münster, das Seminar für evangelische Theologie der Universität Siegen, die Karl Barth-Gesellschaft e.V. und die Johannes-a-Lasco Bibliothek in Emden.
Zur Eröffnung des Symposions „Karl Barth als Lehrer der Versöhnung“, sprach Prof. Dr. Georg Plasger in der Johannes a Lasco Bibliothek.
Die Versöhnungslehre Karl Barths ist Thema eines internationalen Symposions Anfang Mai in Emden.